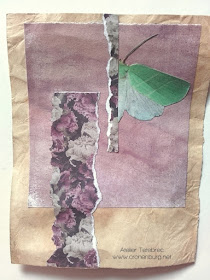Demnächst bin ich beim Jahresessen unseres Museumvereins eingeladen, von dem ich lange nicht alle Mitglieder kenne. Wir sind samt PartnerInnen immerhin so viele, dass wir eine ganze Mehrzweckhalle füllen. Und es wird sicherlich so schön wie bei unseren Festen im Museum: Man kann mit wildfremden Leuten am Tisch nette Gespräche haben. Hilfreich gegen die Hemmschwelle oder auch Ängste mancher Menschen sind dann meist diejenigen, die ich als "
connectors" bezeichnen möchte:
Menschen, die vermittelnd wirken und einfach mal zwei getrennte Wesen an die Hand nehmen und zusammenführen. Die eine Unterhaltung wieder neu entfachen, wenn sie zu ersterben droht, weil nicht jede/r so geübt ist, mit Unbekannten loszuquasseln. Ist das Eis gebrochen, sind alle Seiten glücklich. Diese "
connectors" wirken wie Medizin.
 |
| Ochsen sagt man Sturheit nach, was sie wohl über Menschen sagen würden? |
Als wahres Kontrastprogramm bekam ich heute bei Twitter live einen Einblick ins sogenannte
Sifftwitter, dessen Mitglieder an nichts anderem arbeiten, als 24 Std. am Tag Hass und politische Verfolgung zu organisieren und zu streuen. Aber darum soll es nicht gehen. Ich will auch nicht die alte Leier anwerfen, Social Media seien ja ach so übel. Nö, denn gerade bei Twitter habe ich auch fantastische und interessante Kontakte machen können. Ich will in diesem Jahr auf das Positive, Konstruktive schauen: Was ist bei diesen positiven Kontakten so anders? Warum funktionieren sie in einer Weise, dass man sich völlig spontan auch im Echtleben auf einen Kaffee treffen würde?
Ich muss ausholen, was dieser Beitrag soll. Ähnlich wie die meisten bin ich immer mehr überwältigt und überfordert von Horrornachrichten und apokalyptischen Bildern, deren Ausblenden die Welt aber auch nicht besser machen würde - sondern nur mich dümmer. Dazu die Kriegsgefahr durch Dumpforange - als hätten wir nicht genügend massive Probleme zu lösen. Heute Sifftwitter dazu und ich meinte scherzhaft zu einer Bekannten,
jetzt könne ich einen Schnaps gebrauchen. Ich saß beim Frühstück, der Schnaps war natürlich rein virtuell. Aber er zeigte mir, was in diesem Moment dringend nötig war:
Ich wollte mich mit etwas nähren. Mich nähren mit etwas, das vermeintlich schnell und durchschlagend hilft: Medizin.
Weil der Bedarf an Medizin gegen Widrigkeiten öfter hochkommt, interessiere ich mich derzeit für Menschen und Angebote, die das leisten. Die konstruktiv damit umgehen, dass wir in so einer tumultartigen Wendezeit leben. Und ich lese das Buch "Braiding Sweetgrass" von
Robin Wall Kimmerer, das mich ziemlich überrascht hat. Ich dachte, ich hätte Nature Writing von einer Biologin gekauft, würde Fakten über die Natur lernen
***. Stattdessen interessiert sich die Wissenschaftlerin für genau die Fragen, die mir auf den Nägeln brennen:
Wie schaffen wir es, in diesen Zeiten nicht durchzudrehen, nicht in Schwärze oder Hoffnungslosigkeit zu versinken, sondern durchaus glücklich zu leben und zuversichtlich zu handeln? Was könnte unsere Medizin sein, wie können wir uns selbst nähren? Oder wie es viel zu flach in der Coaching-Erleuchtungsliteratur heißt: "unsere Akkus aufladen." Flach deshalb, weil es doch wieder nur das kapitalistisch ausbeutbare Bild des perfektionierten und funktionierenden Menschen kolportiert, dem andere den Strom abzapfen.
Nun hat Robin Wall Kimmerer als
Native eine eigene, uralte Medizin und schenkt uns damit einen neuen alten Blick auf die Natur und menschliches Miteinander, aber auch das Miteinander aller Lebewesen. Davon können wir viel lernen. Überhaupt wird es Zeit, endlich einmal auf das zu hören, was indigene Völker dieser Erde uns zu sagen haben. Aber das einfach zu kopieren, wäre auch nur eine Aneignung. Kimmerer hat jedoch diese faszinierende Art, so offen und allgemeingültig davon zu erzählen, dass wir selbst draufkommen:
Traditionen des Miteinanders habe wir auch! Wir haben sie nur vergessen.
 |
| Früher hatte jeder mindestens einen Hausbaum in Hausnähe im Garten. |
In meiner Lebensspanne habe ich das noch erlebt. Als ich ins Elsass zog, also vor etwa 30 Jahren,
haben die alten Leute auf dem Land noch ihren Hausbaum gegrüßt. Es war ein völlig normales Ritual der Wertschätzung, das die Jüngeren nicht wunderte. Alte Männer zogen den Hut, ein Bonjour murmelnd, manche nickten nur leicht, manche schämten sich vor anderen und beließen es bei einem längeren Blick. Den "Hausbaum" pflanzte man bei der Geburt eines Kindes, in der Zeit der Hausgeburten vergrub man damit die Plazenta zur Düngung - und natürlichen Entsorgung. Es waren oft Baumarten, die einmal die Kinder nähren konnten: Obst- und Nussbäume oder als Schnapslieferant und Medizin Holunder. Frauen teilten da also ein Stück von sich selbst und Männer ihre Energie mit einem Lebewesen, dessen Früchte viele Jahrzehnte später noch die Kinder nähren würde. Vergangenheit und Zukunft wurden gedacht im Moment des Pflanzens. Zum Dank grüßten die Leute ihre Hausbäume täglich beim Gehen oder Kommen und hinterließen ihnen an bestimmten Festtagen oder einfach als Dankeschön Geschenke. Etwas Kaffeesatz oder Gemüsekompost, aber auch mal ein Glas Wein oder den kalten Rest Milchkaffee. Bäume und Menschen begegneten sich als Lebewesen, nährten sich gegenseitig.
Und ja, das ist der Baum, über den heute alle lachen, wenn es heißt, man habe ein Haus gebaut, ein Kind gezeugt und einen Baum gepflanzt. Heute versteht kaum noch jemand, dass ein Baum zur Familie gehören kann. Können wir überhaupt wieder zu einem Zustand gelangen, indem wir die Lebewesen dieser Erde wirklich als solche wahrnehmen und wertschätzen - und dabei gleichzeitig vom üblen Irrtum der "Krone der Schöpfung" runterkommen? (
Anm. 1)
Da ist noch eine Geschichte, die ich vielleicht schon einmal erwähnt habe: die von den gärtnernden Mäusen. Sie ist vielleicht am rechten Platz, wenn manche Menschen nur noch dunkelste Apokalyptik verbreiten. Ich meine damit ausdrücklich nicht die Menschen, die sachlich Katastrophen wahrnehmen und warnen oder sich für den Klimaschutz engagieren. Sondern die Gefühlsextremisten, die vorsätzlich aus oft recht eigennützigen Gründen Panik schüren und gleichzeitig die verlachen, die Handlungsspielräume sehen und einfach mal machen.
Die gärtnernden Mäuse lehren mich, dass alles mit allem zusammenhängt und der oberflächliche Schein oft trügt.
Es geht um Bilbos "Buddelwiese", eine große, an Felder und Wald angrenzende Wiesenfläche, die vom Bauern genutzt wird und eine der wenigen ist, die
im Frühjahr im Goldgelb wilder Schlüsselblumen leuchtet. Die sind selten geworden in den Nordvogesen, stehen unter Schutz und waren auf dieser Wiese fast ausgerottet.
 |
| Ende März / April leuchten die Schlüsselblumen mit dem Löwenzahn um die Wette. |
Das Problem war zunächst der Bauer selbst, der sich immer größere Maschinen auslieh. Muss er, weil er immer weniger verdient, also schneller fertig sein muss. Das wollen die VerbraucherInnen so.
Und so hat er mit der Zeit mit seinem Trecker den Boden immer übler verdichtet, immer öfter Heu gemacht und die Wiese noch mehr geschädigt. Manche Wildblumen blieben aus, auch Schlüsselblumen blühten nur noch sehr vereinzelt hier und da. Und in den Jahren der Dürre, als das Gras auf der Wurzel verbrannte, ging es dem Boden anderweitig nicht gut.
Plötzlich kamen die Mäuse, Heerscharen. Feldmäuse, habe ich festgestellt (ohne genau zu wissen warum), siedeln sich hier besonders stark auf solch geschädigten Böden an. Ob es die Bodenverdichtung ist, das niedrigere Gras oder das Mistauffahren im späten Winter - ich weiß es nicht. Heute kann ich auf diesen Wiesen nur noch laufen, wenn ich aufmerksam den Boden beachte. Zu leicht verknackst man sich den Fuß in den Löchern, in trockenen Sommern brechen ganze Gänge ein. Für Bilbo ein Schnüffelparadies.
Feldmäuse, die zu den Wühlmäusen gehören, erkennt man daran, dass sie vor ihrem Mausloch alles kurz fressen und auch auf ihren oberirdischen Gängen alle Vegetation abweiden. Sieht aus wie Straßenbau. Sie fressen Gras, Kräuter, Samen und auch mal Getreide. Aber sie sind wählerisch.
Das sieht man daran, dass in solchen Wiesen Tuffs von Gras stehenbleiben, oder Wiesenblumen.
Wie ich diese Wiese über Jahre hinweg beobachte, haben sie die Mäuse verwandelt. Bestimmte samenreiche Blütenpflanzen vermehren sich stärker. So kam ich auf die eher witzig gemeinte Bezeichnung der gärtnernden Mäuse: Sie fressen diese Pflanzen nicht an, wohl aber speisen sie ihre Samen. Gleichzeitig hat sich eine neue Grasart um ihre Nester und auf den Gängen verbreitet, die es früher nicht gab. Es ist ein sehr dicht wachsendes, extrem feines Gras, das ich erst bestimmen kann, wenn es Blüten haben wird. Es wird von ihnen nicht angerührt. Es ist, als würden die Mäuse nicht nur bestimmte Blumen, sondern auch diese kleinen Graspolster züchten. Zwischen denen wiederum wachsen neuerdings alle möglichen Wildkleearten, Ampfer oder Glatthafer.
 |
| Wir dürfen den Blick für das Winzige nicht verlieren. |
Letzteren hat jemand anderes angeschleppt, denn der wuchs früher nur am Waldrand. Diese Grassorte ist vitamin- und mineralstoffreich und süß, Bilbo nutzt sie für die Verdauung, Wildschweine lieben sie. Und die kommen seit einigen Jahren auf diese Wiesen, weil sie noch etwas anderes gern fressen: Klee, Ampfer und - vor allem Mäuse! Ein Leckerbissen. Bei der Kälte müssen sie ihnen nur an ihren Gängen auflauern oder ein wenig nachhelfen: Die Mauseburgzentren werden aufgewühlt.
Zu den niedlichen "Mäusegärtchen" mit dem dichten Kleingras kommen die Saukuhlen, in denen das Wasser steht. In den feuchten Brachen siedeln sich neue Kräuter an und Feuchtwiesenblumen. Dabei schleppen die Wildschweine im Pelz und Kot neue Samen mit, wie eben den Glatthafer; gärtnern, wenn man so will, auf ihre Weise mit.
Natürlich schmeckt das Aufwühlen dem Bauern gar nicht. Aber weil Zeit und Geld fehlen, bosselt er gar nicht mehr so viel herum wie früher, um die Tiere zu bekämpfen. Er hat nämlich bemerkt, dass beide Spezies an der Durchlüftung seiner Wiese arbeiten und es reicht, den Boden im Frühjahr nur einmal oberflächlich zu vertikulieren!
Vor allem hat er gesehen: Die Wildschweine und auch Raubvögel halten die Mauspopulation in Schach. Jetzt verteilen sich manche Pflanzen noch leichter.
Und die Schlüsselblumen? Die mögen die freigefressenen Maus"straßen" und die feuchten Wildschweinkuhlen noch mehr als den Boden früher. Das Vertikulieren macht ihnen nichts aus, im Gegenteil, es teilt ganze Polster zu Einzelpflanzen, die wiederum neue Polster bilden. Und so sind auch irgendwie die Mäuse daran schuld, dass es auf einer zu sehr bearbeiteten Wiese wieder seltene Schlüsselblumen gibt. Noch mehr haben sie geschafft:
Das von ihnen geförderte Gras ist extrem trockenheitsresistent. Es war als einziges in den letzten Dürrejahren im Sommer grün und hat damit den Boden geschützt. Es hält Feuchtigkeit im Boden und schützt Bodenleben und Humus. Und das Ende der Geschichte? Dieser Bauer kann einmal mehr im Jahr Heu machen, während seine KollegInnen in die Röhre schauen. Auf den Wiesen ohne Mäuse war alles vertrocknet, wirklich alles.
Mich nähren diese Mäuse. Sie lehren mich, dass in einem Ökosystem nichts unsinnig ist, was so mancher Laie dazu erklärt. Vor allem aber zeigen sie mir, wie faszinierend Natur sich organisieren kann, wenn man sie nur in Ruhe lässt und nicht gleich alles zum Schädling erklärt, was man nicht mag. Natürlich werden die Wildschweine geschossen, wenn sie überhand nehmen. Aber eben auch nur dann. Denn sie sorgen dafür, dass es nicht zuviele Mäuse gibt.
Alle zusammen fördern die Blütenvielfalt der Wiese und die wiederum Schmetterlinge, Wildbienen, Insekten.
Natur ist so eine Medizin, die wir dringend brauchen. Natürlich müssen wir genau hinschauen, wenn es um Artensterben oder das Zugrunderichten von Lebensräumen und Biotopen geht. Um das aber wirklich richtig zu kapieren, um uns überhaupt berühren zu lassen, müssen wir einen neuen Blick für die Natur bekommen. Einmal alle Besserwisserei fahrenlassen und von unseren Mitgeschöpfen lernen: den Tieren, den Pflanzen und Pilzen, dem Bodenleben und allem, was wir nur unterm Mikroskop erkennen können. Wie leben die alle miteinander, was teilen sie miteinander? Wo wird die Balance gestört, weil plötzlich etwas fehlt oder etwas anderes zuviel ist? Wo und warum sind wir einfach nur Störenfriede wie dieser ungebetene nervende Besuch, der einfach nicht gehen will?
Diese Art von Medizin ist nichts, was man sich einfach mit einem Rezept abholt und konsumiert. Sie wird einem geschenkt, wenn man die Perspektive verschiebt und komische Sachen fragt. Etwa: Was wäre, wenn Mäuse Gärtner wären? Vielleicht könnten wir dann auch den Umgang mit den Menschen besser hinbekommen? Was wäre wenn ...?
*** Wenn ich öfter Dinge im Blog mehrfach erwähne, liegt es wie in diesem Fall nicht an Vergesslichkeit. Manches begleitet mich länger, in immer neuen Aspekten. Und da mein Blog nicht nur von StammleserInnen angesteuert wird, sondern viel via Google, möchte ich auch ZufallsleserInnen die wichtigsten Zusammenhänge bieten.
Anm. 1: Der Urtext spricht von Mitgeschöpflichkeit und einer Rolle der Menschen als
"Gärtner" im altmesopotamischen Sinn, d.h. als HegerIn und PflegerIn der
Schöpfung. Das waren damals mehr Pflichten, Ökosysteme zu erhalten, kein Grund für Hybris.
Anm. 2: Ich möchte an dieser Stelle denjenigen danken, die es durch Spenden für meine Blogarbeit (rechts im Menu unter "Wer liebt, gibt") ermöglichen, dass ich mich auch ausführlich solch zeitaufwändigeren Themen wie diesem widmen kann!